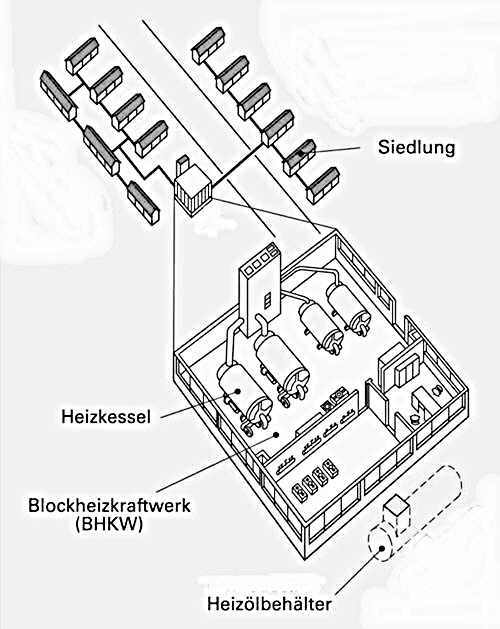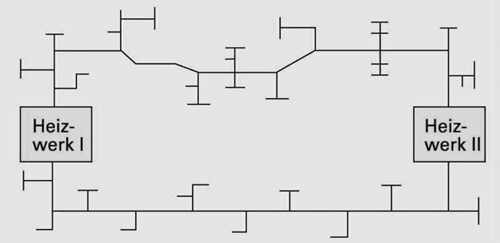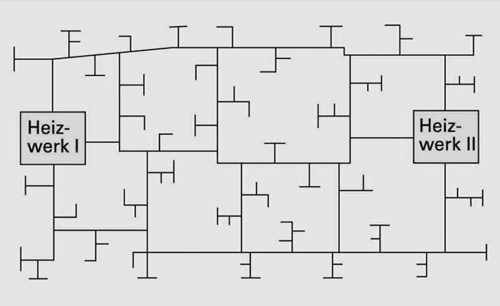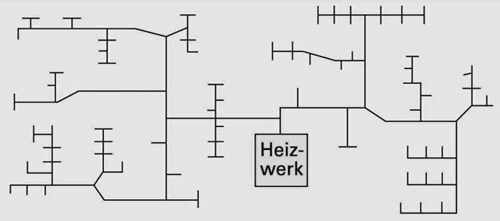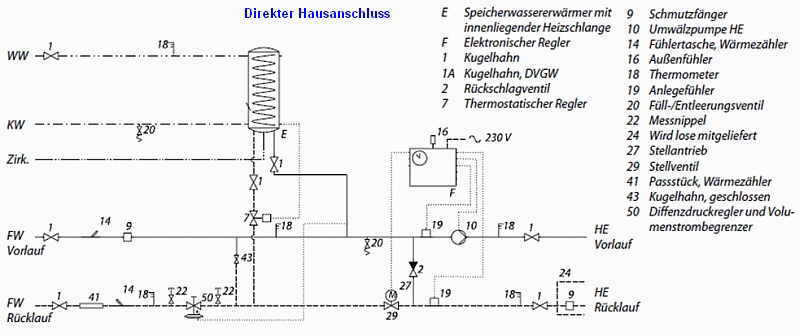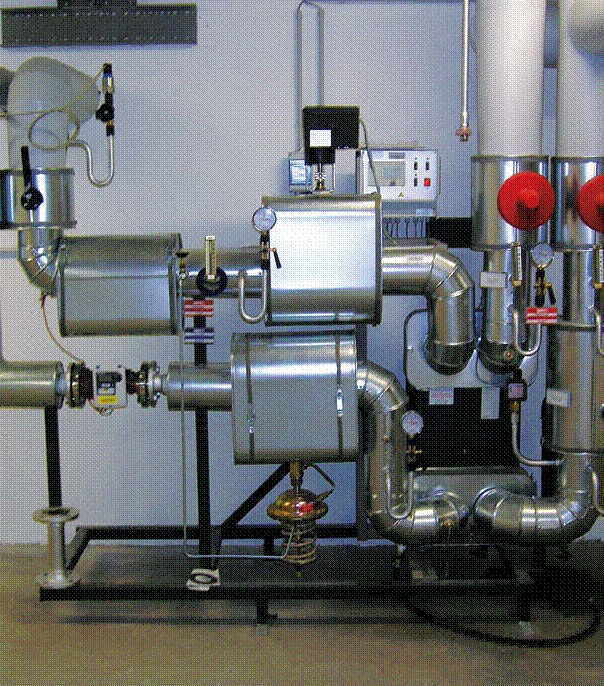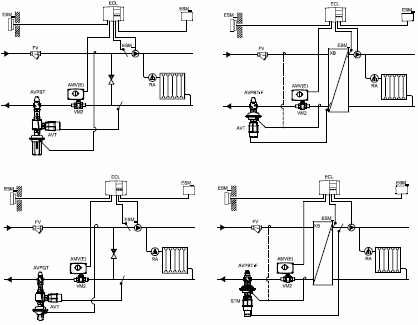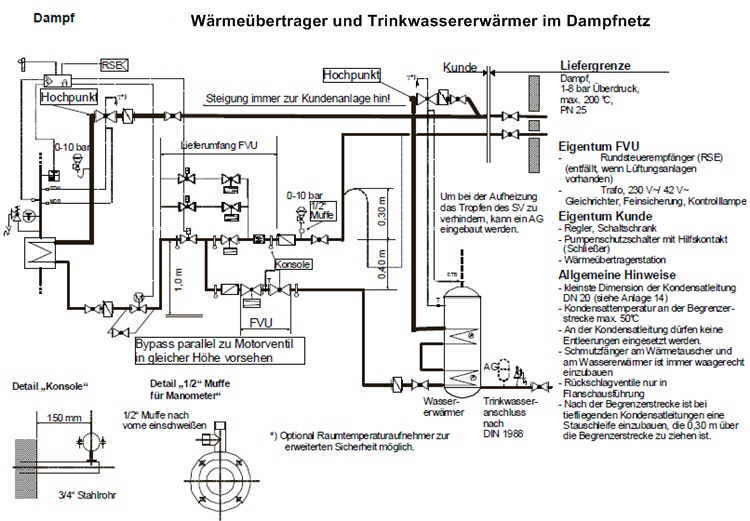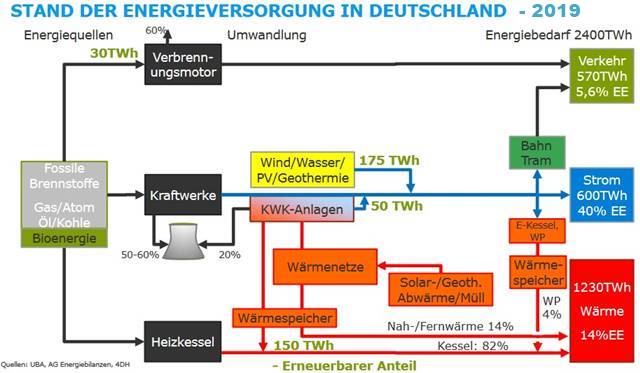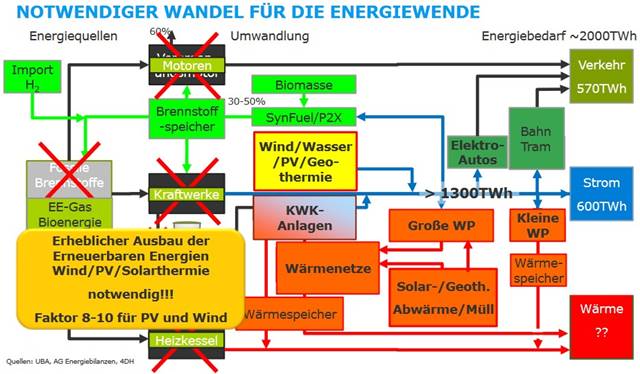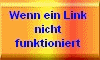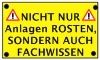Fernwärme
![]() Wärmecontracting
- Wärmelieferung
Wärmecontracting
- Wärmelieferung![]()
Geschichte
der Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Solartechnik
Abkürzungen
im SHK-Handwerk
Bosy-online-ABC
Das Rohrleitungssystem
besteht aus einer Vorlaufleitung, die den Abnehmer mit Heizwasser
versorgt und einer Rücklaufleitung, die das möglichst tief abgekühlte
Wasser wieder zum Wärmeerzeuger zurückführt, wo es erneut
erwärmt wird. Pumpen sorgen für die Wärmeverteilung im
Netz. Eine Druckhalteanlage verhindert das Verdampfen des heißen
Wassers.
Großwärmepumpen in deutschen Fernwärmenetzen
Projektträger Jülich | Forschungszentrum Jülich GmbH
Einbindung von Wärmepumpen in Fernwärmenetze
heatbeat engineering GmbH & heatbeat nrw GmbH
Brennbare Gase im Wärmenetz
Quelle: Danfoss GmbH Übergabestationen für die Fernwärme |
|
|
-Hydraulischer Aufbau, Funktionsbeschreibung und Regelsystem-
Fernwärme-/Nahwärmeübergabestation
Eine kompakte Übergabestation zur hydraulischen
Entkoppelung der Nah- und Fernwärmeversorgung
von Gebäuden hat den Vorteil, dass alle notwenigen Bauteile
(Wärmetauscher, Armaturen, Wärmemengenzähler, Regelung)
auf kleinstem Raum vorhanden sind und eine passende Dämmung
(z. B. EPP-Dämmsystem [Expandiertes Polypropylen]) werkseitig vorhanden
ist.
Die Komponenten (Sekundär-Heizkreis,
Frischwasserstation,
Regelung)
sind in einer Sandwich-click-Konstruktion mit Stabilisatoren
und einer aufgesetzten Wärmedämmhaube selbsttragend
verbaut. Die Anschlüsse der Primär- und Sekundärmedien
(Warmwasser, Heißwasser) sind sowohl oben als auch unten frei wählbar.
Alle sicherheitstechnischen Bauteile, Entleerungen bzw. Spülanschlüsse,
Entlüftung und Manometer können in die Fernwärmestation
integriert werden.
Bei den in die Rohrstrecken integrierten, mit Feinsieben
bestückten, Schmutzfängern sind sowohl primär
als auch sekundär Spülanschlüsse nachrüstbar.
Der Wärmemengenzähler ist von außen frei
zugänglich und ablesbar. Der eingesetzte
Wärmetauscher aus Edelstahl ist
durch seine große thermische Länge in einem breiten Leistungsspektrum
einsetzbar. Der Fühler für die Sekundär-Vorlauftemperatur
ist entgegen der Strömungsrichtung
direkt am Ausgang des Wärmetauschers platziert. Das sekundärseitig
integrierte Sicherheitsventil dient zur hydraulischen Absicherung
der Fernwärmestation. Thermometer für die Primär-
und Sekundärseite sind in der Türblende
des in Blech ausgeführten Schaltschrankes enthalten.
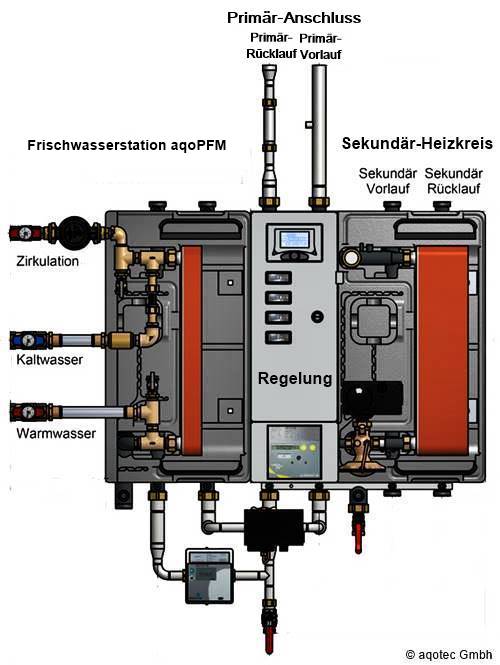
Fernwärmeübergabestation
aqoClick mit außenliegendem Wärmezähler
Quelle: aqotec Gmbh
Fernwärme-Kompaktstation
für indirekten Anschluss an Fernwärmenetze - Bedienungs-
und Wartungsanleitung
|
|
|
Vor
dem Einbau eines Regelventils in die Rohrleitung muss die
Anlage fachgerecht
gespült und wenn erforderlich, gereinigt
werden. Außerdem ist für das Heizungswasser
mindestens die VDI
Richtlinie 2035 zu beachten. Für Industrie-
und Fernwärmeanlagen ist das VdTÜV-Merkblatt
1466/AGFW-Merkblatt 5/15 zu beachten. |
|
|
Nahwärmesysteme zur Wärme-, Kälte- und Wasserversorgung
Uponor Ecoflex
Uponor GmbH
Vorgedämmte Rohrleitungen + Leitungen
für Heizung, Kälte, Sanitär- und Thermalleitungen
Thermaflex
GmbH
Flexiblen und starren Nahwärmerohre und Fernwärmerohre
BRUGG Rohrsystem AG
Das Rohrsystem Radius® FibreFLEX PN 10
ENERPIPE GmbH
Hochdruckdampfheizungen arbeiten mit Überdrücken >1,0 bar (Sattdampf und Heißdampf [überhitzter Dampf - 300 bis 600 °C]). In der Praxis wird Hochdruckdampf in Heizungsanlagen nicht mehr eingesetzt. Aber in der Fernwärmeversorgung, in Fabriken (Luftheizgeräte) und bei der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) wird der Vorteil des hohen Dampfdruckes weiterhin angewendet., wobei Strömungsgeschwindigkeiten bei Sattdampf von 20 bis 30 m/s und bei Heißdampf von 30 bis 50 m/s gefahren werden.